Qualität / Qualitätssicherung
Unsere Artikel zu: alle
()
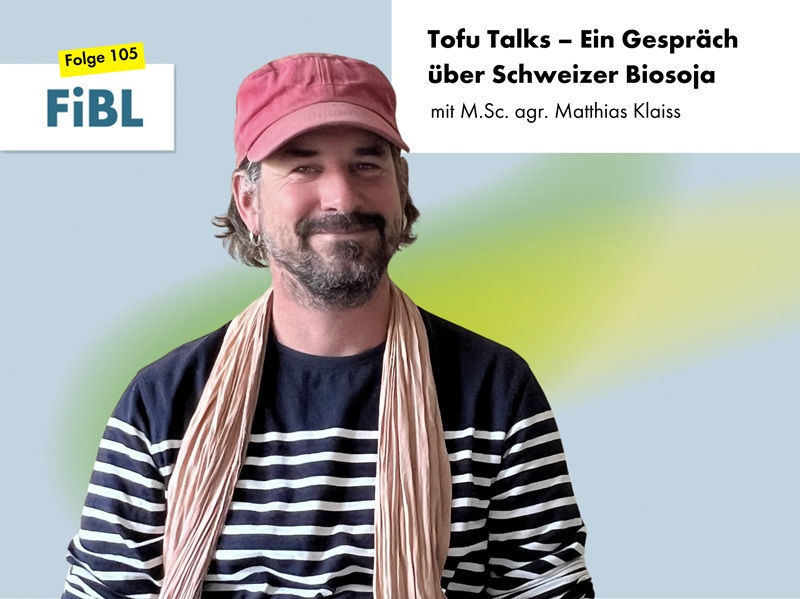
18.11.2025
Podcast "Tofu Talks – Ein Gespräch über Schweizer Biosoja"
In dieser Folge von "FiBL Focus" spricht Anke Beermann mit FiBL Forscher Matthias Klaiss über den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz. Als Autor des neuen Merkblatts "Biologischer Anbau von Soja" gibt er praxisnahe Einblicke in eine Kulturpflanze, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, sowohl für die Fütterung als auch für die ...
In dieser Folge von "FiBL Focus" spricht Anke Beermann mit FiBL Forscher Matthias Klaiss über den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz. Als Autor des neuen Merkblatts "Biologischer Anbau von Soja" gibt er praxisnahe Einblicke in eine Kulturpflanze, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, sowohl für die Fütterung als auch für die menschliche Ernährung.
|44|43|
Mehr lesen
2025
FiBL
fibl.org: Podcast \"Tofu Talks – Ein Gespräch über Schweizer Biosoja\"
0_1763462108
1763462108

18.11.2025
Podcast "Bohne gut, alles gut – die Lupinenrevolution"
Lupinen sind nicht nur als Blumen im Garten eine Augenweide, sondern auch gut für Bienen und Hummeln. Sie sind auch wahre Proteinwunder und könnten unsere Ernährung revolutionieren. Wie das geht, wird in der neuen Podcast-Folge von "FiBL Focus" behandelt.
Lupinen sind nicht nur als Blumen im Garten eine Augenweide, sondern auch gut für Bienen und Hummeln. Sie sind auch wahre Proteinwunder und könnten unsere Ernährung revolutionieren. Wie das geht, wird in der neuen Podcast-Folge von "FiBL Focus" behandelt.
|44|41|48|46|
Mehr lesen
2025
FiBL
fibl.org: Podcast \"Bohne gut, alles gut – die Lupinenrevolution\"
0_1763462075
1763462075

18.11.2025
Merkblatt: Biologischer Anbau von Soja
Das Merkblatt informiert über alle für den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz relevanten Aspekte.
Das Merkblatt informiert über alle für den biologischen Anbau von Soja in der Schweiz relevanten Aspekte.
fibl.org: Merkblatt "Biologischer Anbau von Soja"
|38|43|
Mehr lesen
2025
FiBL
fibl.org: Merkblatt \"Biologischer Anbau von Soja\"
0_1763461352
1763461352

30.10.2025
Gemeinsam die Sorten der Zukunft finden am BioLeguminosenTag 2025
Wie können Züchtung und Verarbeitung zusammenarbeiten, um das volle Potenzial von Hülsenfrüchten für die Lebensmittelproduktion zu nutzen? Dieser Frage widmete sich der BioLeguminosenTag 2025 mit Fachvorträgen, einem Workshop sowie einer Betriebsführung bei der New Roots AG. Der BioLeguminosenTag fand im Rahmen der Tage der Agrarökologie statt. Abgerundet wu...
Wie können Züchtung und Verarbeitung zusammenarbeiten, um das volle Potenzial von Hülsenfrüchten für die Lebensmittelproduktion zu nutzen? Dieser Frage widmete sich der BioLeguminosenTag 2025 mit Fachvorträgen, einem Workshop sowie einer Betriebsführung bei der New Roots AG. Der BioLeguminosenTag fand im Rahmen der Tage der Agrarökologie statt. Abgerundet wurde der von gzpk und FiBL organisierte Tag durch Degustationen und einen feinen Apéro.
Ganzen Artikel lesen (bioaktuell.ch)
Rückblick-Video (youtube.com)
|40|44|41|43|46|
Mehr lesen
2025
FiBL
Ganzen Artikel lesen (bioaktuell.ch)
Rückblick-Video (youtube.com)
0_1761830021
1761830021

17.09.2025
Mischkultur im Fokus: Rückblick Flurbegehung Hülsenfrüchte
Im Juni fand im Rahmen des Protein Power Networks eine Flurbegehung in Lichtenstein statt zu verschiedensten Hülsenfruchtkulturen. Im Fokus der Diskussionen stand die Frage nach geeigneten Mischpartnern für Leguminosen.
Im Juni fand im Rahmen des Protein Power Networks eine Flurbegehung in Lichtenstein statt zu verschiedensten Hülsenfruchtkulturen. Im Fokus der Diskussionen stand die Frage nach geeigneten Mischpartnern für Leguminosen.
Die Flurbegehung verschiedenster Hülsenfruchtkulturen am 26. Juni in Lichtenstein war spannend – und ziemlich nass. Im Rahmen des Protein Power Networks führte Florian Bernardi vom Verein Feldfreunde (www.feldfreunde.li) zu Feldern voller Ackerbohnen, Linsen, Soja, Kichererbsen und Platterbsen. Im strömenden Regen gaben Landwirte Einblick in den Anbau und in die Herausforderungen des Jahres 2025, was fruchtvolle Diskussionen bezüglich Praktiken und möglichen Mischkulturen hervorrief. Die Flurbegehung endete im trockenen Verarbeitungsraum des Biohof Näschers. Dort zeigte Andreas Näscher den Teil der Wertschöpfungskette nach dem Feld. Er führte die Gruppe durch die hofeigene Anlage, welche für Reinigung, Sortierung und Lagerung gerüstet wurde.
Die Diskussionen kreisten mehrheitlich um die optimalen Mischpartner für Leguminosen. Als mögliche Mischkulturen wurden zum Beispiel Platterbsen mit Hafer, oder Linsen mit Gerste, Hafer oder Hirse besprochen. Eine weitere Erkenntnis war, dass das Timing von Saatzeitpunkt und Reife in Mischkulturen gut aufeinander abgestimmt sein muss, damit bei der Ernte beide Kulturen reif sind. Besonders für Linsen und Platterbsen ist ausserdem eine stabile Stützfrucht und ebenso das optimale Mischverhältnis wichtig, damit Verluste aufgrund von Lagerung vermindert werden können.
||
Mehr lesen
2025
Die Flurbegehung verschiedenster Hülsenfruchtkulturen am 26. Juni in Lichtenstein war spannend – und ziemlich nass. Im Rahmen des Protein Power Networks führte Florian Bernardi vom Verein Feldfreunde (www.feldfreunde.li) zu Feldern voller Ackerbohnen, Linsen, Soja, Kichererbsen und Platterbsen. Im strömenden Regen gaben Landwirte Einblick in den Anbau und in die Herausforderungen des Jahres 2025, was fruchtvolle Diskussionen bezüglich Praktiken und möglichen Mischkulturen hervorrief. Die Flurbegehung endete im trockenen Verarbeitungsraum des Biohof Näschers. Dort zeigte Andreas Näscher den Teil der Wertschöpfungskette nach dem Feld. Er führte die Gruppe durch die hofeigene Anlage, welche für Reinigung, Sortierung und Lagerung gerüstet wurde.
Die Diskussionen kreisten mehrheitlich um die optimalen Mischpartner für Leguminosen. Als mögliche Mischkulturen wurden zum Beispiel Platterbsen mit Hafer, oder Linsen mit Gerste, Hafer oder Hirse besprochen. Eine weitere Erkenntnis war, dass das Timing von Saatzeitpunkt und Reife in Mischkulturen gut aufeinander abgestimmt sein muss, damit bei der Ernte beide Kulturen reif sind. Besonders für Linsen und Platterbsen ist ausserdem eine stabile Stützfrucht und ebenso das optimale Mischverhältnis wichtig, damit Verluste aufgrund von Lagerung vermindert werden können.
0_1758112167
1758112167

02.06.2025
Eichmühle
Die Eichmühle in Beinwil AG veredelt Hülsenfrüchte und andere Spezialkulturen - von der Annahme über die Reinigung bis zur Schälung.
Die Eichmühle in Beinwil AG veredelt Hülsenfrüchte und andere Spezialkulturen - von der Annahme über die Reinigung bis zur Schälung.
Die Eichmühle AG ist ein innovatives Getreidecenter mit modernster Infrastruktur in Beinwil AG. Das Angebot umfasst zum Beispiel die Veredelung von Reis, Linsen, Dinkel und Kürbiskernen sowie die Annahme von Saatgut wie Raps, Weizen, Dinkel oder Mais. Ausserdem werden Gourmetprodukte wie Urdinkel-Kernotto hergestellt.
eichmuehle.swiss: Webseite der Eichmühle
|47|
Mehr lesen
Die Eichmühle AG ist ein innovatives Getreidecenter mit modernster Infrastruktur in Beinwil AG. Das Angebot umfasst zum Beispiel die Veredelung von Reis, Linsen, Dinkel und Kürbiskernen sowie die Annahme von Saatgut wie Raps, Weizen, Dinkel oder Mais. Ausserdem werden Gourmetprodukte wie Urdinkel-Kernotto hergestellt.
eichmuehle.swiss: Webseite der Eichmühle
0_1748878562
1748878562
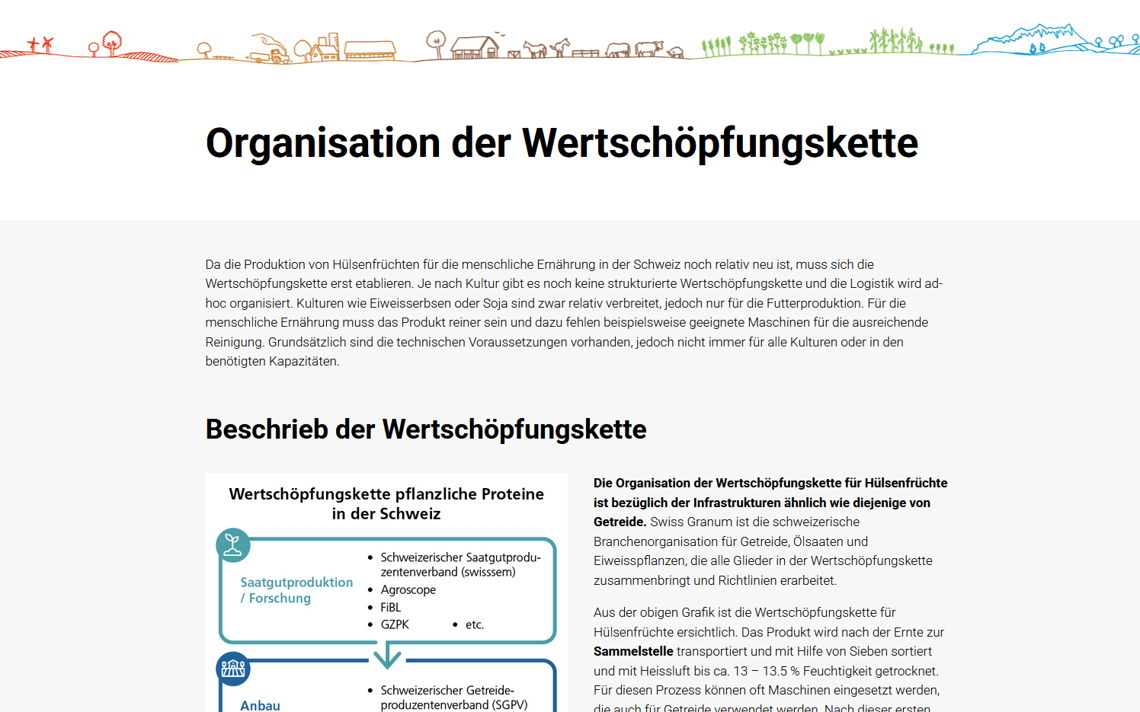
18.03.2025
Wertschöpfungsketten von Hülsenfrüchten
In diesem Artikel wird die Wertschöpfungskette von Hülsenfrüchten dargestellt, inklusive der wichtigsten Schweizer Stakeholder. Die grösste Herausforderung ist aktuell die geringe Verarbeitungsmenge.
In diesem Artikel wird die Wertschöpfungskette von Hülsenfrüchten dargestellt, inklusive der wichtigsten Schweizer Stakeholder. Die grösste Herausforderung ist aktuell die geringe Verarbeitungsmenge.
|44|46|
Mehr lesen
Artikel: Organisation der Wertschöpfungsketten
0_1742311663
1742311663
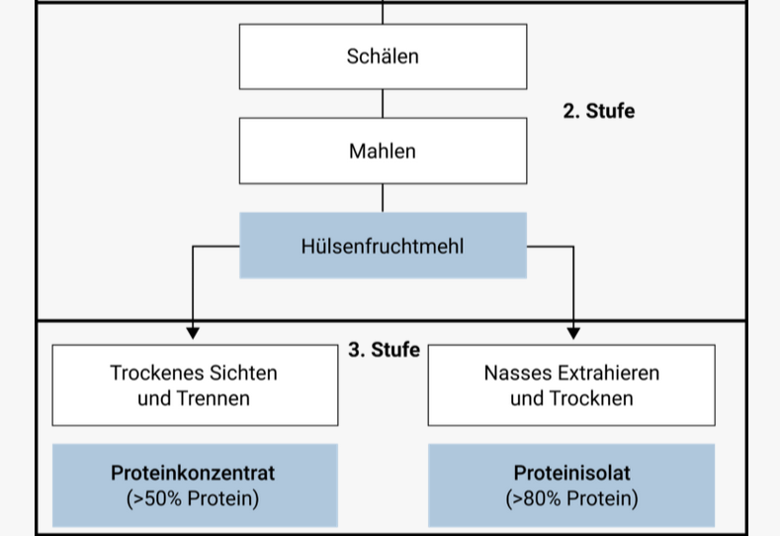
18.03.2025
Übersicht Verarbeitungsstufen
Nicht alle Hülsenfrüchte können direkt verkauft werden, da Konsument*innen z.B. nicht an unverarbeiteten Soja gewöhnt sind. Folgender Artikel gibt eine Zusammenfassung über die verschiedenen möglichen Verarbeitungsstufen für Hülsenfrüchte.
Nicht alle Hülsenfrüchte können direkt verkauft werden, da Konsument*innen z.B. nicht an unverarbeiteten Soja gewöhnt sind. Folgender Artikel gibt eine Zusammenfassung über die verschiedenen möglichen Verarbeitungsstufen für Hülsenfrüchte.
|44|46|
Mehr lesen
Artikel: Übersicht Verarbeitungsstufen
0_1742305214
1742305214

18.03.2025
Coop Plant Based Food Report 2025
Wie steht die Schweizer Bevölkerung aktuell zu veganen Ersatzprodukten? Der neue Plant Based Food Report von Coop zeigt die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage auf.
Wie steht die Schweizer Bevölkerung aktuell zu veganen Ersatzprodukten? Der neue Plant Based Food Report von Coop zeigt die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage auf.
|44|48|
Mehr lesen
Artikel: Plant Based Food Report 2025
0_1742304261
1742304261

11.03.2025
Übersicht Marktentwicklung und Politik
In diesem Artikel von Agridea gibt es einen Überblick zu Marktzahlen vom Verkauf pflanzlicher Proteine in den letzten Jahren. Ausserdem werden Importmengen verglichen und die politischen Rahmenbedingungen skizziert.
In diesem Artikel von Agridea gibt es einen Überblick zu Marktzahlen vom Verkauf pflanzlicher Proteine in den letzten Jahren. Ausserdem werden Importmengen verglichen und die politischen Rahmenbedingungen skizziert.
Hier geht es zum Artikel: Pflanzliche Proteine: Marktentwicklung und Politik
|44|48|
Mehr lesen
2025
Agridea
Hier geht es zum Artikel: Pflanzliche Proteine: Marktentwicklung und Politik
0_1741683691
1741683691

28.01.2025
Karte: Übersicht von Lohnverarbeitungsbetrieben
Hier findest du eine Übersicht über Betriebe, welche auch Kleinmengen für die Direktvermarktung verarbeiten. Einige davon verarbeiten bereits Hülsenfrüchte. Lohnverarbeitungsbetriebe können sich hier registrieren, um ihre online-Sichtbarkeit zu erhöhen.
Hier findest du eine Übersicht über Betriebe, welche auch Kleinmengen für die Direktvermarktung verarbeiten. Einige davon verarbeiten bereits Hülsenfrüchte. Lohnverarbeitungsbetriebe können sich hier registrieren, um ihre online-Sichtbarkeit zu erhöhen.
Wer Rohstoffe vom eigenen Hof zu Lebensmitteln verarbeiten lassen möchte, findet auf dieser interaktiven Karte eine Übersicht von Lohnverarbeitungsbetrieben, die verschiedenste Arten der Lohnverarbeitung anbieten. Die aufgeführten Metzgereien, Mostereien, Mühlen und anderen Betriebe ermöglichen Verarbeitungsschritte für die Biolebensmittelherstellung oder stellen ihre Verarbeitungsräume und -maschinen zur Verfügung.
Lohnverarbeitungsbetriebe können sich jetzt anmelden, um online präsent zu sein.
Hier geht es zu der Karte mit Lohnverarbeitungsbetrieben:
https://www.bioaktuell.ch/verarbeitung/lohnverarbeitung/lohnverarbeitungsbetriebe-finden
|46|
Mehr lesen
Wer Rohstoffe vom eigenen Hof zu Lebensmitteln verarbeiten lassen möchte, findet auf dieser interaktiven Karte eine Übersicht von Lohnverarbeitungsbetrieben, die verschiedenste Arten der Lohnverarbeitung anbieten. Die aufgeführten Metzgereien, Mostereien, Mühlen und anderen Betriebe ermöglichen Verarbeitungsschritte für die Biolebensmittelherstellung oder stellen ihre Verarbeitungsräume und -maschinen zur Verfügung.
Lohnverarbeitungsbetriebe können sich jetzt anmelden, um online präsent zu sein.
Hier geht es zu der Karte mit Lohnverarbeitungsbetrieben:
https://www.bioaktuell.ch/verarbeitung/lohnverarbeitung/lohnverarbeitungsbetriebe-finden
0_1738069956
1738069956

28.01.2025
Fostering Collaboration and Innovation in Switzerland in Culinary Practices
Interested in faba beans for human consumption?
Interested in faba beans for human consumption?
This article describes the latest work of the Swiss team in the project IntercropVALUES, which promotes, amongst others, the intercropping of wheat and faba beans for food production. The team organised a multi-stakeholder workshop and invited chefs in West Switzerland to experiment with faba bean flour in their kitchen. As a result, a cook from a nursery experimented with faba bean flour in bread, which led to very satisfactory outcomes.
Read the complete article:
https://intercropvalues.eu/case-studies/fostering-collaboration-and-innovation-in-switzerland-in-culinary-practices/
|39|
Mehr lesen
This article describes the latest work of the Swiss team in the project IntercropVALUES, which promotes, amongst others, the intercropping of wheat and faba beans for food production. The team organised a multi-stakeholder workshop and invited chefs in West Switzerland to experiment with faba bean flour in their kitchen. As a result, a cook from a nursery experimented with faba bean flour in bread, which led to very satisfactory outcomes.
Read the complete article:
https://intercropvalues.eu/case-studies/fostering-collaboration-and-innovation-in-switzerland-in-culinary-practices/
0_1738059657
1738059657

05.06.2024
Lupinen als pflanzliche Milch-Alternative? «Durchblick» Podcast
Im Podcast "Durchblick" von Blick erzählt Christine Arncken vom FiBL Schweiz ab Minute 27:00 über das Potential von Lupinen für pflanzliche Milchalternativen.
Was kommt bei dir in den Kaffee oder ins Müesli? Kuhmilch oder eine Alternative aus Soja, Hafer oder Mandeln? Die Pflanzendrinks boomen – doch sind sie auch gesund? Und wie gross ist die Umweltbelastung? Diesen Fragen geht der Podcast «Durchblick» auf den Grund.
Christine Arncken vom FiBL Schweiz erzählt ab Minute 27:00 über das Potential von Lupinen. Diese können dem Soja Konkurrenz machen. Sie werden auch "Sojabohnen des Nordens" genannt, da sie kältetoleranter als Soja sind. Lupinen enthalten alle 21 essenziellen Aminosäuren sowie Eisen, ausserdem wirken sie gegen Bluthochdruck und antidiabetisch. Für Milchalternativen haben sie allerdings geschmackliche Nachteile.
Der Podcast erschien am 25.04.2024.
||
Anschauen
Blick
Was kommt bei dir in den Kaffee oder ins Müesli? Kuhmilch oder eine Alternative aus Soja, Hafer oder Mandeln? Die Pflanzendrinks boomen – doch sind sie auch gesund? Und wie gross ist die Umweltbelastung? Diesen Fragen geht der Podcast «Durchblick» auf den Grund.
Christine Arncken vom FiBL Schweiz erzählt ab Minute 27:00 über das Potential von Lupinen. Diese können dem Soja Konkurrenz machen. Sie werden auch \"Sojabohnen des Nordens\" genannt, da sie kältetoleranter als Soja sind. Lupinen enthalten alle 21 essenziellen Aminosäuren sowie Eisen, ausserdem wirken sie gegen Bluthochdruck und antidiabetisch. Für Milchalternativen haben sie allerdings geschmackliche Nachteile.
Der Podcast erschien am 25.04.2024.
0_1717587350
1717587350

29.02.2024
Pflanzliche Proteine als Fleischersatz: eine Betrachtung für die Schweiz
Soll die Eigenversorgung an pflanzlichem Protein für die menschliche Ernährung ausgebaut werden, bedarf es einer möglichst gesamthaften Betrachtung. In dieser Studie wird die Situation in der Schweiz systemisch analysiert. Es wird aufgezeigt, welche proteinreichen Pflanzen sich besonders für einen nachhaltigen und ökologischen Anbau eignen, welches ernährung...
Soll die Eigenversorgung an pflanzlichem Protein für die menschliche Ernährung ausgebaut werden, bedarf es einer möglichst gesamthaften Betrachtung. In dieser Studie wird die Situation in der Schweiz systemisch analysiert. Es wird aufgezeigt, welche proteinreichen Pflanzen sich besonders für einen nachhaltigen und ökologischen Anbau eignen, welches ernährungsphysiologische Potenzial sie mitbringen und welche Prozessschritte notwendig sind, um sie zu Proteinkonzentraten und -isolaten aufzuarbeiten, die sich wiederum zur Herstellung von Fleischersatzprodukten eignen.
|44|46|
Mehr lesen
2018
Agrarforschung Schweiz
Artikel auf agrarforschungschweiz.ch
0_1709194035
1709194035
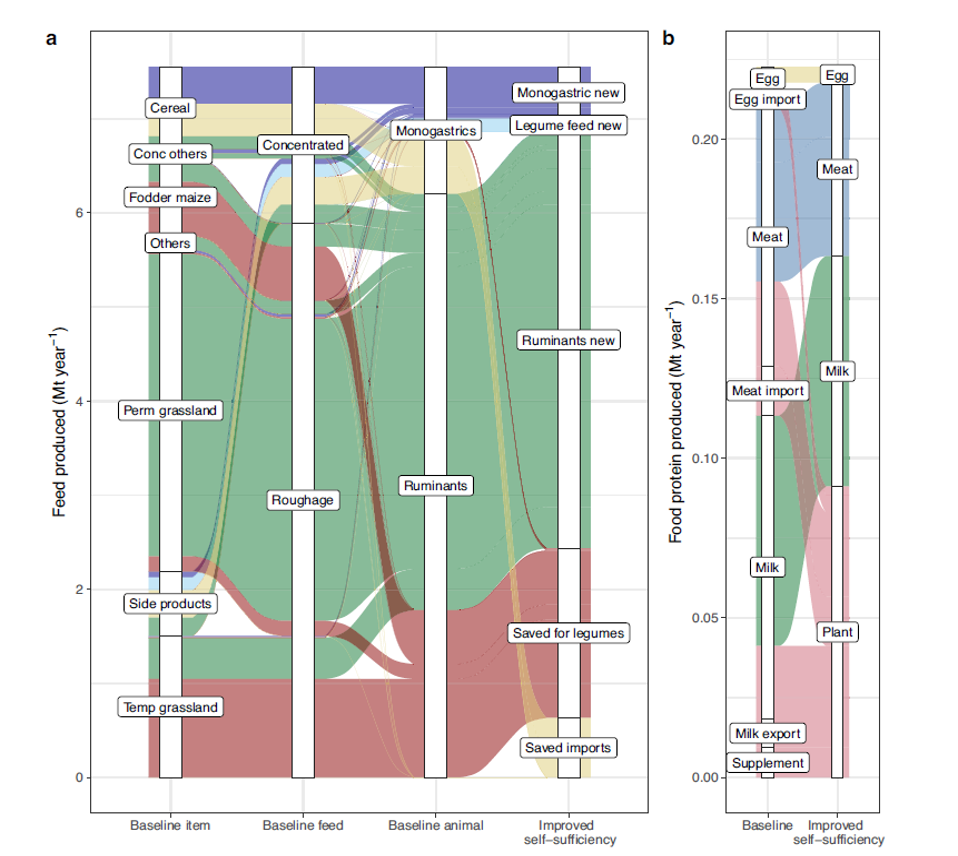
16.02.2024
Umstellung auf Körnerleguminosen ist Chance für mehr Nachhaltigkeit
Die Schweizer Landwirtschaft kann nachhaltiger und autarker werden, indem sie vom Futtermittel- auf den Körnerleguminosenanbau umstellt.
Switzerland’s livestock production causes high environmental costs and depends strongly on feed imports. While plant-based protein demand increases, the local grain legume production is negligible ( ~ 9000 hectares). Here, we investigated the potential of sustainable legume protein production based on an expert survey followed by a quantitative analysis base...
Switzerland’s livestock production causes high environmental costs and depends strongly on feed imports. While plant-based protein demand increases, the local grain legume production is negligible ( ~ 9000 hectares). Here, we investigated the potential of sustainable legume protein production based on an expert survey followed by a quantitative analysis based on yield, soil, terrain and climate data. Pea, soybean and faba bean showed high potential for Swiss agriculture given adaptions in policy, pricing and breeding. The potential grain legume production area was 107,734 hectares on suitable arable land (Scenario I). Switzerland’s self-sufficiency could be increased by cutting imports and maximizing legume production on 181,479 hectares (Scenario II) in expense of grassland and fodder maize. This would replace approximately 41% of animal protein consumption with plant-based protein, preserving 32% of milk and 24% of meat protein. In conclusion, domestic legume production could be substantially increased while improving human and environmental health.
Link zum ETH-Blog: Anbauschlacht mit Hülsenfrüchten
|48|
Mehr lesen
2024
Nature
Link zum ETH-Blog: Anbauschlacht mit Hülsenfrüchten
0_1708093338
1708093338
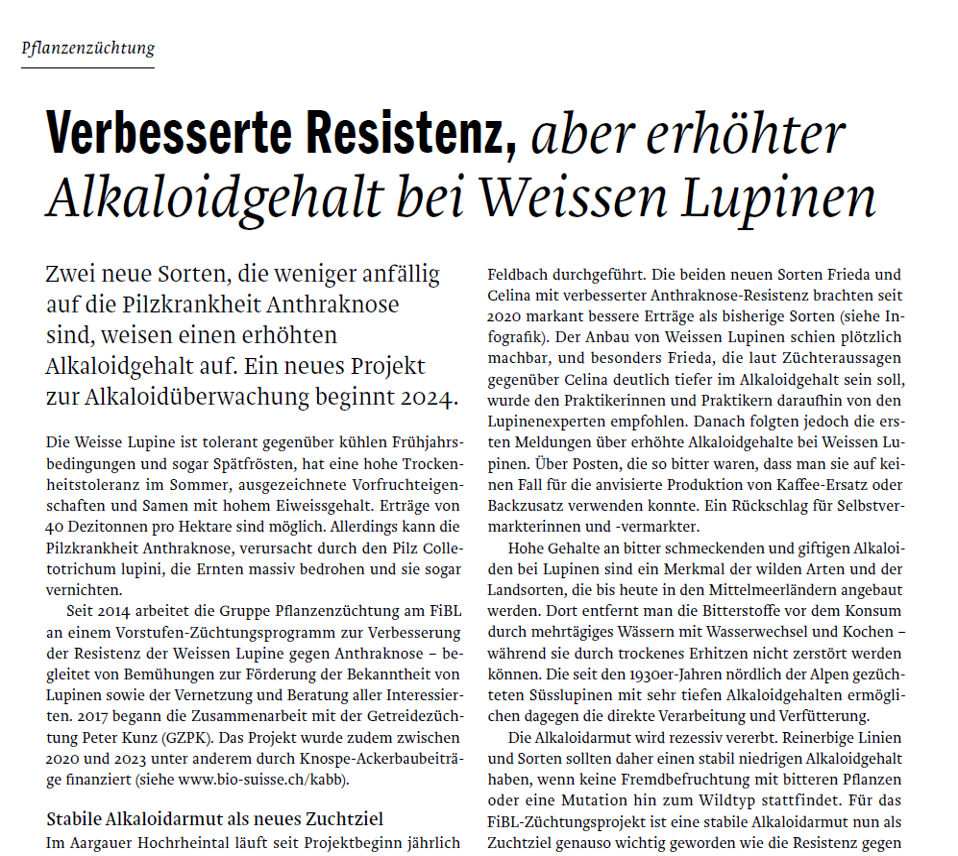
16.02.2024
Verbesserte Resistenz, aber erhöhter Alkaloidgehalt bei Weissen Lupinen
Zwei neue Sorten, die weniger anfällig auf die Pilzkrankheit Anthraknose sind, weisen einen erhöhten Alkaloidgehalt auf. Ein neues Projekt zur Alkaloidüberwachung beginnt 2024.
Zwei neue Sorten, die weniger anfällig auf die Pilzkrankheit Anthraknose sind, weisen einen erhöhten Alkaloidgehalt auf. Ein neues Projekt zur Alkaloidüberwachung beginnt 2024.
|38|41|
Mehr lesen
2024
Bioaktuell
0_1708071647
1708071647
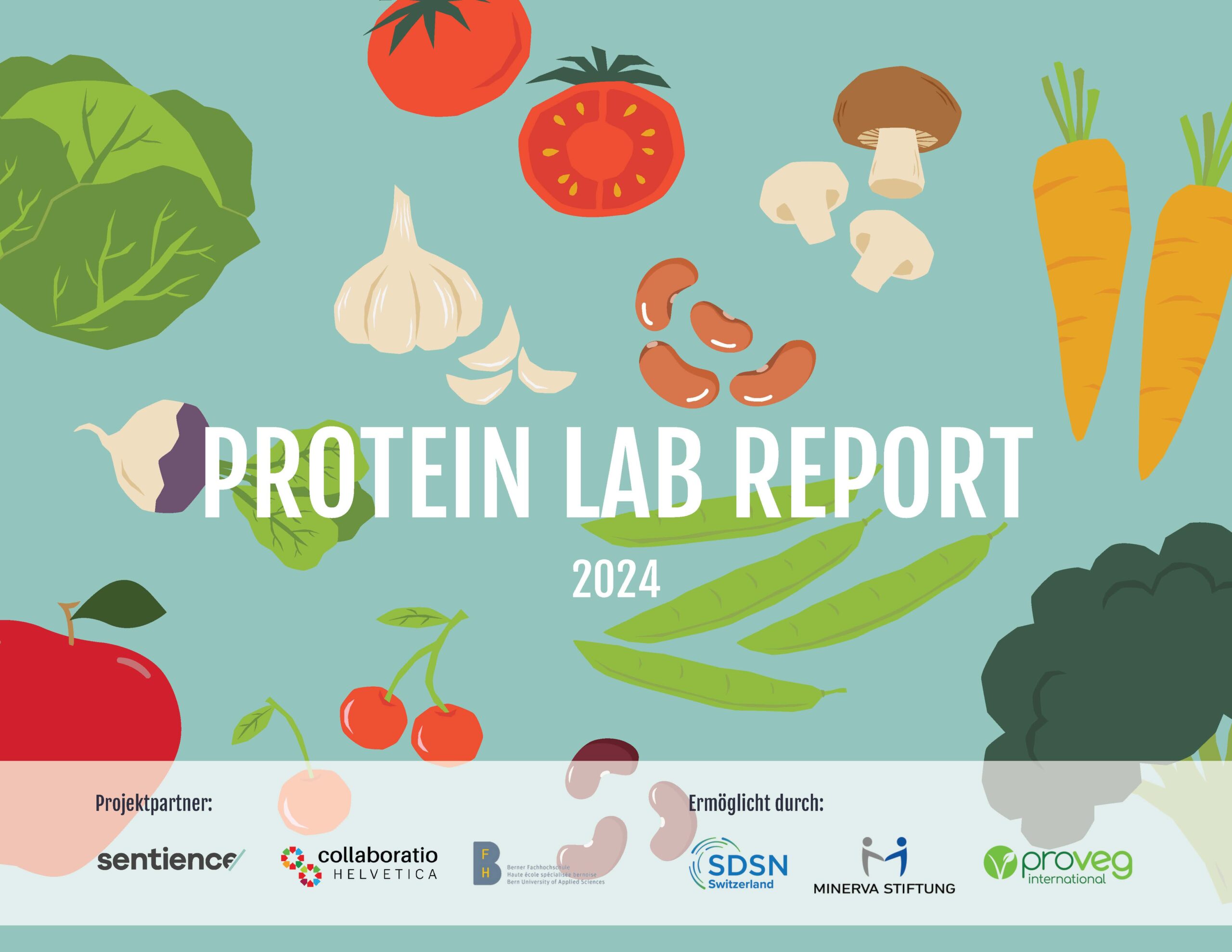
15.02.2024
Protein Lab Report 2024
Das Schweizer Ernährungssystem steht vor der grossen Herausforderung, die Umweltauswirkungen des aktuellen Fleischkonsums zu reduzieren und den ethischen Aspekten der Massentierhaltung gerecht zu werden. Die Proteinwende ist die Antwort darauf, doch regulatorische Hürden und mangelnde Vernetzung innerhalb der pflanzlichen Proteinbranche erschweren diesen Wan...
Das Schweizer Ernährungssystem steht vor der grossen Herausforderung, die Umweltauswirkungen des aktuellen Fleischkonsums zu reduzieren und den ethischen Aspekten der Massentierhaltung gerecht zu werden. Die Proteinwende ist die Antwort darauf, doch regulatorische Hürden und mangelnde Vernetzung innerhalb der pflanzlichen Proteinbranche erschweren diesen Wandel.
Das Protein Lab wurde ins Leben gerufen, um Akteure aus verschiedenen Bereichen des Ernährungssystems zusammen zu führen, systemische Barrieren zu analysieren und kooperative Lösungen zu fördern. Mit der Einführung neuer Methoden und eines systemischen Ansatzes förderte das Protein Lab das Verständnis des komplexen Ernährungssystems und das Bewusstsein über die Notwendigkeit von kooperativer Zusammenarbeit der sich darin befindenden Akteure. Es konnten bedeutende Hebelpunkte innerhalb und ausserhalb des Proteinsystems identifiziert werden, die für den benötigten Wandel aktiviert werden müssen.
|48|43|
Mehr lesen
2024
Sentience, collaboratio helvetica, Berner Fachhochschule
0_1708004155
1708004155
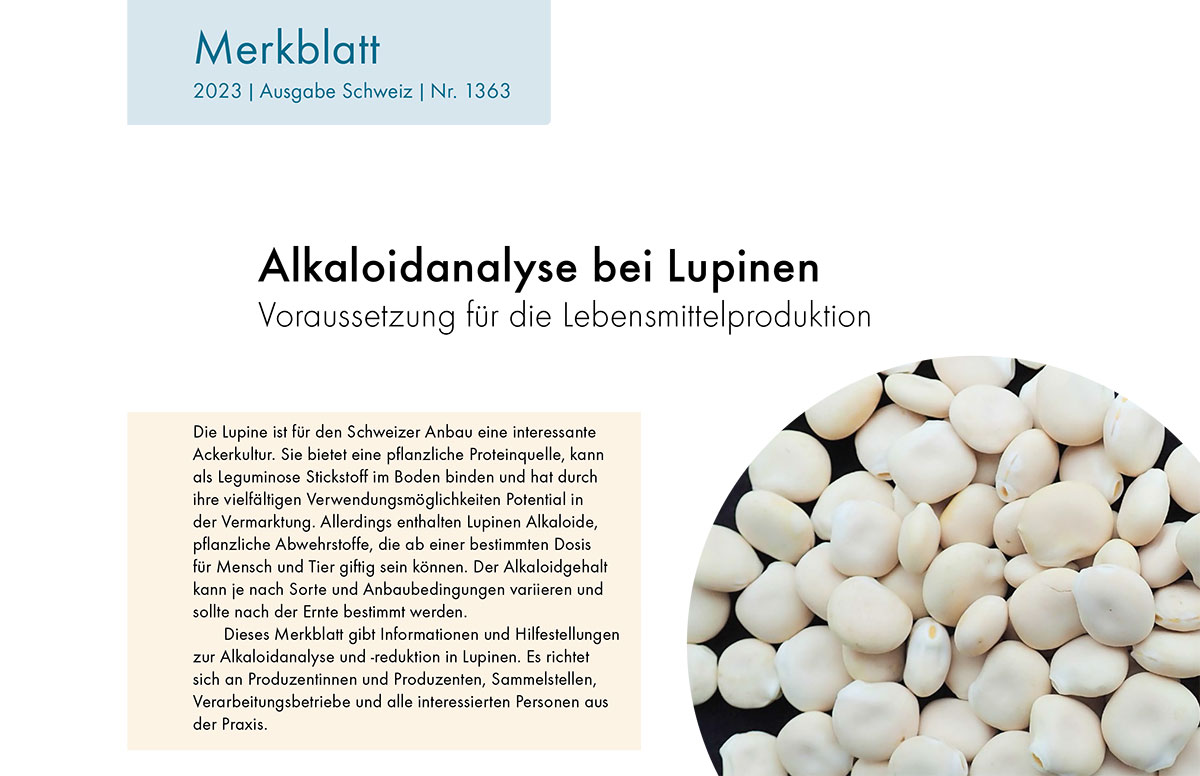
24.07.2023
Alkaloidanalyse bei Lupinen
Voraussetzung für die Lebensmittelproduktion
Die Lupine ist für den Schweizer Anbau eine interessante Ackerkultur. Sie bietet eine pflanzliche Proteinquelle, kann als Leguminose Stickstoff im Boden binden und hat durch ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten Potential in der Vermarktung. Allerdings enthalten Lupinen Alkaloide, pflanzliche Abwehrstoffe, die ab einer bestimmten Dosis für Mensch und Ti...
Die Lupine ist für den Schweizer Anbau eine interessante Ackerkultur. Sie bietet eine pflanzliche Proteinquelle, kann als Leguminose Stickstoff im Boden binden und hat durch ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten Potential in der Vermarktung. Allerdings enthalten Lupinen Alkaloide, pflanzliche Abwehrstoffe, die ab einer bestimmten Dosis für Mensch und Tier giftig sein können.
Der Alkaloidgehalt kann je nach Sorte und Anbaubedingungen variieren und sollte nach der Ernte bestimmt werden. Dieses Merkblatt gibt Informationen und Hilfestellungen zur Alkaloidanalyse und -reduktion in Lupinen. Es richtet sich an Produzentinnen und Produzenten, Sammelstellen, Verarbeitungsbetriebe und alle interessierten Personen aus der Praxis.
|38|44|41|45|
Mehr lesen
2023
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
0_1690206584
1690206584

11.07.2023
Richtpreise für Biofuttergetreide und Eiweisspflanzen erhöht
Anlässlich der Richtpreisrunde vom 17. Mai 2022 haben Produzentenvertreter, Mischfutterhersteller und Importeure die Richtpreise für Knospe-Futtergetreide und Eiweisspflanzen angepasst.
Anlässlich der Richtpreisrunde vom 17. Mai 2022 haben Produzentenvertreter, Mischfutterhersteller und Importeure die Richtpreise für Knospe-Futtergetreide und Eiweisspflanzen angepasst.
|44|48|
Mehr lesen
2022
Bio Suisse
0_1689081460
1689081460

28.06.2023
Soja Factsheet
Körnerleguminose mit Pfahlwurzel, die bis zu 1.5m lang werden kann. Nur 20 bis 80% der Blüten setzen Hülsenfrüchte an.
Körnerleguminose mit Pfahlwurzel, die bis zu 1.5m lang werden kann. Nur 20 bis 80% der Blüten setzen Hülsenfrüchte an.
|38|43|
Mehr lesen
2021
Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau
0_1687954345
1687954345

28.06.2023
Lupinen Factsheet
Lupinen gehören zu den Leguminosen. Man unterscheidet zwischen wilden/ Gartenlupinen und Süsslupinen (weisse, blaue und gelbe Lupinen). Wilde und Gartenlupinen sind giftig auf-grund der Gerbstoffe.
Lupinen gehören zu den Leguminosen. Man unterscheidet zwischen wilden/ Gartenlupinen und Süsslupinen (weisse, blaue und gelbe Lupinen). Wilde und Gartenlupinen sind giftig auf-grund der Gerbstoffe.
|38|41|
Mehr lesen
2021
Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau
0_1687953445
1687953445

27.06.2023
Eiweisserbsen Factsheet
Die Eiweisserbse gehört zu der Familie der Leguminosen und kann somit Luftstickstoff fixieren. Es han-delt sich um eine grosskörnige Leguminose, die sich vielseitig als Kraftfutterkomponente einsetzen lässt.
Die Eiweisserbse gehört zu der Familie der Leguminosen und kann somit Luftstickstoff fixieren. Es han-delt sich um eine grosskörnige Leguminose, die sich vielseitig als Kraftfutterkomponente einsetzen lässt.
|38|40|
Mehr lesen
2021
Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau
0_1687873458
1687873458

27.06.2023
Kichererbsen Factsheet
Kichererbsen gehören zu den Hülsenfrüchten und können eine Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien eingehen. Pro Hülse sind ein bis drei Kichererbsen enthalten (i.d.R. zwei).
Kichererbsen gehören zu den Hülsenfrüchten und können eine Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien eingehen. Pro Hülse sind ein bis drei Kichererbsen enthalten (i.d.R. zwei).
|38|
Mehr lesen
2021
Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau
0_1687871617
1687871617

27.06.2023
Ackerbohne Factsheet
Grosskörnige Leguminose mit geeigneter Proteinqualität für die Milchviehfütterung und guter Durch-wurzelung des Bodens. Es wird zwischen Winter- und Sommerackerbohnen unterschieden, wobei sich diese bezüglich Vegetationsdauer, Anzahl Seitentriebe und Blütezeit unterscheiden.
Grosskörnige Leguminose mit geeigneter Proteinqualität für die Milchviehfütterung und guter Durch-wurzelung des Bodens. Es wird zwischen Winter- und Sommerackerbohnen unterschieden, wobei sich diese bezüglich Vegetationsdauer, Anzahl Seitentriebe und Blütezeit unterscheiden.
|39|38|
Mehr lesen
2021
Strickhof, Bereich Pflanzenbau und Agrartechnik, Eschikon 21, CH-8315 Lindau
0_1687864775
1687864775

31.05.2023
Marktpotential für Lupinen aus Schweizer Anbau
Bericht
Wir brauchen in der Schweiz ein ausgewogeneres Ernährungssystem das mehr Gewicht auf eine pflanzliche Ernährung setzt. Sowohl auf Produktions- als auch Konsumseite haben tierische Produkte einen zu hohen Stellenwert (BLV, 2021; BLW, 2021a) 1 . Dieses Ungleichgewicht zwischen pflanzlichen und tierischen Produkten sprengt un...
Wir brauchen in der Schweiz ein ausgewogeneres Ernährungssystem das mehr Gewicht auf eine pflanzliche Ernährung setzt. Sowohl auf Produktions- als auch Konsumseite haben tierische Produkte einen zu hohen Stellenwert (BLV, 2021; BLW, 2021a) 1 . Dieses Ungleichgewicht zwischen pflanzlichen und tierischen Produkten sprengt unsere planetaren Grenzen (Willett et al., 2019). Um dem Klimawandel und dem Verlust an Biodiversität entgegenzuwirken drängt sich eine Transformation des Ernährungssystems auf.
|44|48|
Mehr lesen
2023
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
0_1685539677
1685539677

31.05.2023
Lupinen für die Humanernährung – Bekanntheit und Akzeptanz in der Schweiz
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL | Ackerstrasse 113 | Postfach 219 5070 Frick | Schweiz | Tel +41 62 865 72 72 | info.suisse@fibl.org | www.fibl.org Konsumentenbefragung
Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.
Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzen...
Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.
Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzenbasierten und proteinreichen Produkten der Weissen Lupine aus einer nachhaltigen, regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen.
Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.
Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzenbasierten und proteinreichen Produkten der Weissen Lupine aus einer nachhaltigen, regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen.
Das Projekt umfasst: (1,2) Entwicklung von Sortenkandidaten mit einer Kombination von Alkaloidarmut und Anthraknosetoleranz; (3) Aufbau eines Züchtungsprogramms der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) zur Entwicklung von Sorten aus dem fortgeschrittenen Genpool des FiBL; (4) Prüfen der Anbaueignung und Umweltstabilität von Sortenkandidaten und Marktsorten; (5) Identifikation des Marktpotenzials der weissen Lupine, Befragungen, Berechnungen und Vernetzung der Akteure in der gesamten Wertschöpfungskette mit Durchführung von Workshops, insbesondere für Verarbeiter.
Mit der Konsumentenbefragung wurde auf ein konkretes Bedürfnis des sich im Aufbau bestehenden Netzwerks reagiert. So wurde im Stakeholder Workshop vom 19.01.22 das Bedürfnis nach einer genaueren Kenntnis der Bekanntheit und Akzeptanz von Lupinenprodukten bei Konsumierenden identifiziert.
Im Anschluss werden das Studiendesign inklusive Forschungsfragen und die Ergebnisse der Konsumentenforschung präsentiert.
|44|48|
Mehr lesen
2022
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiB
Studie im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE, welches vom Bundesamt für Landwirtschaft gefördert wurde.
Die Konsumentenbefragung wurde im Rahmen des Projekts LUPINNO SUISSE durchgeführt. Hauptziel des Projekts LUPINNO SUISSE ist die Entwicklung von Anthraknose (Brennfleckenkrankheit) -toleranten Sorten mit geringem Alkaloidgehalt, um innovativen, pflanzenbasierten und proteinreichen Produkten der Weissen Lupine aus einer nachhaltigen, regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen.
Das Projekt umfasst: (1,2) Entwicklung von Sortenkandidaten mit einer Kombination von Alkaloidarmut und Anthraknosetoleranz; (3) Aufbau eines Züchtungsprogramms der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) zur Entwicklung von Sorten aus dem fortgeschrittenen Genpool des FiBL; (4) Prüfen der Anbaueignung und Umweltstabilität von Sortenkandidaten und Marktsorten; (5) Identifikation des Marktpotenzials der weissen Lupine, Befragungen, Berechnungen und Vernetzung der Akteure in der gesamten Wertschöpfungskette mit Durchführung von Workshops, insbesondere für Verarbeiter.
Mit der Konsumentenbefragung wurde auf ein konkretes Bedürfnis des sich im Aufbau bestehenden Netzwerks reagiert. So wurde im Stakeholder Workshop vom 19.01.22 das Bedürfnis nach einer genaueren Kenntnis der Bekanntheit und Akzeptanz von Lupinenprodukten bei Konsumierenden identifiziert.
Im Anschluss werden das Studiendesign inklusive Forschungsfragen und die Ergebnisse der Konsumentenforschung präsentiert.
0_1685539382
1685539382
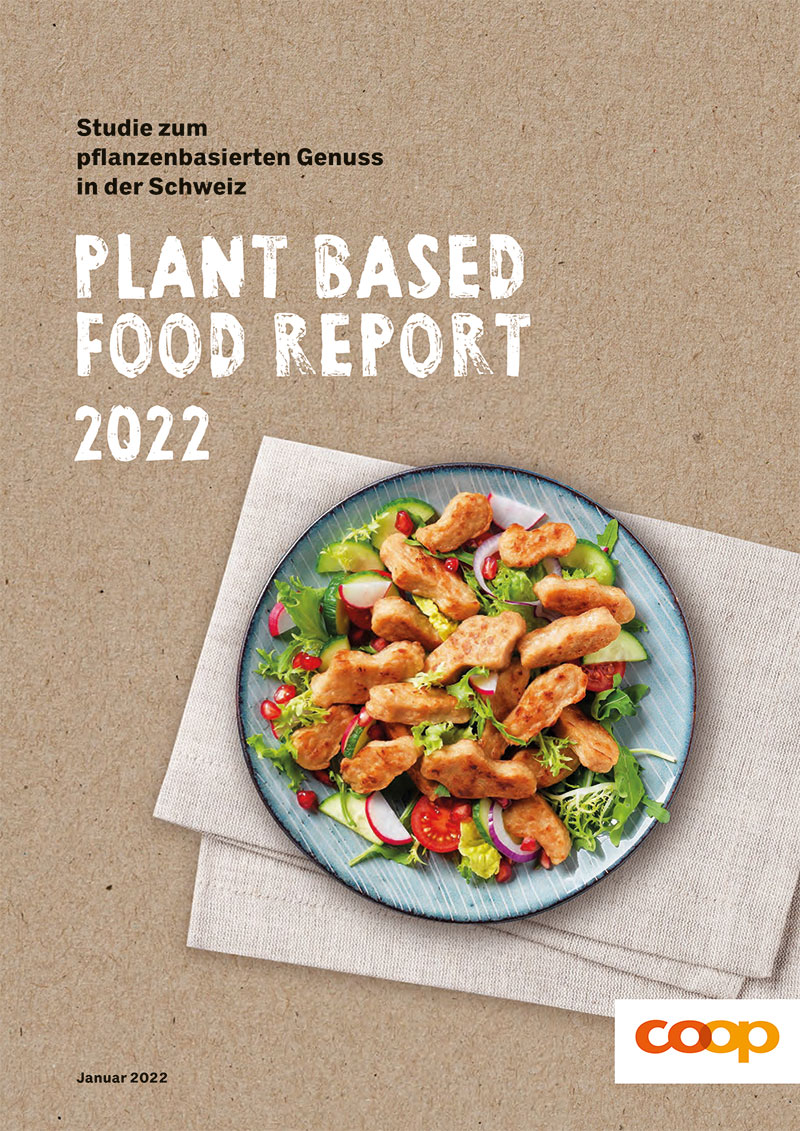
31.05.2023
Studie zum pflanzenbasierten Genuss in der Schweiz
Plant Based Food Report 2022
Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt...
Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren künftigen Konsum ein?
Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original
nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren
künftigen Konsum ein? Der zweite Plant Based Food Report der Schweiz, erstellt von Coop in Zusammenarbeit mit LINK, liefert umfassende Zahlen und Fakten zu diesen und weiteren Fragen rund um die pflanzenbasierte Ernährung, zeigt Trends über die letzten Jahre auf und wirft einen Blick in die Zukunft. Dem Report liegen über 2200 repräsentative Online-Interviews in der ganzen Schweiz, eine Auswertung der anonymisierten Supercard-Verkaufsdaten von Coop sowie Daten von Nielsen zum Schweizer Markt zugrunde.
nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren
künftigen Konsum ein? Der zweite Plant Based Food Report der Schweiz, erstellt von Coop in Zusammenarbeit mit LINK, liefert umfassende Zahlen und Fakten zu diesen und weiteren Fragen rund um die pflanzenbasierte Ernährung, zeigt Trends über die letzten Jahre auf und wirft einen Blick in die Zukunft. Dem Report liegen über 2200 repräsentative Online-Interviews in der ganzen Schweiz, eine Auswertung der anonymisierten Supercard-Verkaufsdaten von Coop sowie Daten von Nielsen zum Schweizer Markt zugrunde.
|44|48|
Mehr lesen
Coop Marktforschung in Zusammenarbeit mit LINK
Was denkt die Schweiz heute über pflanzenbasierte Ernährung? Gibt es immer mehr Substitarier? Also Menschen, die mehrmals pro Monat pflanzliche Ersatzprodukte geniessen, die dem tierischen Original nachempfunden sind. Welche pflanzenbasierten Ersatzprodukte zu Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse werden hierzulande am häufigsten gegessen? Und wie schätzt die Schweizer Bevölkerung ihren künftigen Konsum ein?
Der zweite Plant Based Food Report der Schweiz, erstellt von Coop in Zusammenarbeit mit LINK, liefert umfassende Zahlen und Fakten zu diesen und weiteren Fragen rund um die pflanzenbasierte Ernährung, zeigt Trends über die letzten Jahre auf und wirft einen Blick in die Zukunft. Dem Report liegen über 2200 repräsentative Online-Interviews in der ganzen Schweiz, eine Auswertung der anonymisierten Supercard-Verkaufsdaten von Coop sowie Daten von Nielsen zum Schweizer Markt zugrunde.
0_1685538166
1685538166

30.05.2023
Anbau von Weissen Lupinen
Kältetolerante Eiweissfrucht mit ökologischem Plus
Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten
Saatgut, eine möglichst ...
Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten
Saatgut, eine möglichst frühe Aussaat und die richtige Sortenwahl, um eine Infektion mit der Pilzkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut verbreitet wird, zu vermeiden. Hier werden die wichtigsten Erfahrungen aus dem ökologischen Anbau zusammengefasst.
Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten Saatgut, eine möglichst frühe Aussaat und die richtige Sortenwahl, um eine Infektion mit der Pilzkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut verbreitet wird, zu vermeiden. Hier werden die wichtigsten Erfahrungen aus dem ökologischen Anbau zusammengefasst.
 Abbildung 1. Die Weisse Lupine.
Abbildung 1. Die Weisse Lupine.
 Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.
Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.
 Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.
Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.
 Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.
Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.
 Abbildung 1. Die Weisse Lupine.
Abbildung 1. Die Weisse Lupine.
Anwendbarkeit
Thema: Erfolgreicher Anbau der Weissen Lupine Für: Anbauer von Körnerleguminosen Wo: Kalkarme Böden ohne Staunässe Aussaatzeit: März (April), frühestmöglich Erntezeit: spät! (August-September) Technik: entweder Reihenabstand wie Getreide und ein- bis zweimal striegeln, oder 50 cm Reihenabstand und mehrmals hacken. Mähdrescher Follow-up: Vermarktung vor Aussaat klären. Sehr geeignet als Rohstoff für Nahrungsmittel Bedeutung: Eiweissfrucht ohne N-Düngung mit sehr guter Vorfruchtwirkung, kältetolerantEntscheidungshilfen
Bezogen auf den Proteingehalt der Samen und das Aminosäuremuster, sind Weisse Lupinen nach Sojabohnen für Tierfütterung und menschliche Ernährung die wertvollsten Eiweissfrüchte. Die Erträge liegen meist um die 3 t/ha (Schwankungen von 2 bis 4 t/ha sind möglich). Vorteile gegenüber Sojabohnen sind vor allem die Aussaatmöglichkeit bereits im März (Frost bis -5 °C ist kein Problem), eine bessere Vorfruchtwirkung und deutlich sichtbare Blüten, die attraktiv für Hummeln und Bienen sind. Lupinen gedeihen gut auf sauren, phosphorarmen Böden. Nachteile der Weissen Lupinen sind die Gefahr, durch Anthraknose einen grossen Teil der Ernte zu verlieren, Probleme mit Spätverunkrautung, die relativ späte Ernte (Mitte bis Ende August) und ungeklärte Vermarktungsmöglichkeiten.Zur Vermeidung der Brennfleckenkrankheit
Der wichtigste Schlüssel zum Erfolgist ein Vermeiden der Brennfleckenkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut übertragen wird. Daher sollte nur zertifiziertes Saatgut verwendet werden, das auch optisch „sauber“ aussieht. Alle bisher erhältlichen Sorten sind anfällig auf die Krankheit. In Deutschland ist seit 2019 die weniger anfällige Sorte „Frieda“ zugelassen, die sich im Anbau 2019 an zwei Versuchsorten in der Schweiz bewährt hat. Auch die französische Sorte „Sulimo“ erwies sich bisher (an zwei Orten und in drei Versuchsjahren) als weniger anfällig und sehr ertragsstark. Ab 2020 steht auch die laut Züchter weniger anfällige Sorte „Celina“ zur Verfügung, mit der wir aber noch keine Erfahrungen haben. Am wenigsten Probleme mit Anthraknose gibt es auf sommertrockenen, windreichen Standorten mit pH-Werten unter 7.Erfolgsfaktoren vor dem Anbau
Kalkgehalt des Bodens: Lupinen sind sehr sensibel auf den Kalkgehalt im Boden. Erfahrungen des Forschungsinstituts für biologischen Landbau FiBL in Praxisversuchen zeigen: Bei Gehalten < 3 % ist ein Anbau möglich, zwischen 3-10 % wird ein Tastversuch empfohlen, ab 10 % ist der Anbau nicht möglich. Da Böden mit höherem Kalkgehalt in der Regel auch höhere pH-Werte haben, wird in der Literatur meist nur der pH-Wert als kritische Grösse genannt. In Arbeiten aus Frankreich wurde jedoch gezeigt, dass insbesondere der Kalk (CaCO3) in den feinen Fraktionen Ton und Schluff die Lupinen daran hindert, die Menge an Eisen aus dem Boden aufzunehmen, die die Knöllchen für die Stickstoff-Fixierung brauchen (Duthion 1992). Die Folge ist ein Stickstoffmangel für die Pflanzen, der sich an gelblichen Blättern und kümmerlichem Wachstum zeigt (Kalkchlorose). Auf einem solchen Boden ist auch die Anfälligkeit auf Anthraknose erhöht. Geimpfte Lupinenpflanzen (s. unten) sollten ein kräftiges dunkles Grün haben, ansonsten ist der Boden nicht für den Lupinenanbau geeignet. In der Regel sollte der pH-Wert des Bodens tiefer als 7 sein. Impfung: Lupinensaatgut muss, wie Soja-bohnen, vor dem Anbau mit Knöllchenbakterien geimpft werden. So können die Wurzeln zusammen mit den Bakterien die Stickstoff-fixierenden Knöllchen bilden, und eine Stickstoff-Düngung ist nicht notwendig. Diese Bodenbakterien sind in Böden, auf denen in den letzten Jahren keine Lupinen angebaut wurden, nicht oder nicht in ausreichender Menge vorhanden. Versuche konnten eindrucksvoll zeigen, dass die Impfung leicht zu einer Verdoppelung oder Verdreifachung des Ertrages führt. Das gängigste dieser Impfmittel ist ein schwarzes Pulver auf Torfbasis, das lebende Bakterien enthält. Es kann zusammen mit dem Saatgut im Saatguthandel bestellt werden und wird am besten direkt vor der Aussaat mit dem Saatgut vermischt, bis die Samen rundum schwarz sind. Da UV-Licht die Bakterien tötet, sollte das Impfmittel oder das fertig geimpfte Saatgut vor Sonnenlicht geschützt und kühl gelagert werden (siehe auch Practice Note 1).Erfolgsfaktoren während Anbau und Ernte
Unkrautbekämpfung: Im Vorauflauf wird, auch im konventionellen Anbau, eine Unkrautkur (Falsches Saatbett) oder Blindstriegeln empfohlen (bis 3 Tage nach der Aussaat). Besondere Vorsicht ist geboten, um nicht auf die Saat zu fahren. Die Weissen Lupinen können ca. 4-6 Wochen nach der Aussaat gehackt oder gestriegelt werden (Abbildung 2). Weisse Lupinen werden ähnlich wie Soja gehackt (siehe auch Practice Note 2). Idealerweise sollte Hacken/Striegeln nachmittags durchgeführt werden, wenn der Turgor in den Pflanzen geringer ist, um Verletzungen zu vermeiden. Etwa 8 Wochen nach der Aussaat, zu Beginn der Blütezeit, lohnt sich ein Kontrollgang über das Feld bei trockenem Wetter. Zu dieser Zeit sind die ersten Nester von Anthraknose sichtbar (Abbildung 4) und eine Entfernung und Abführung der befallenen Pflanzen von Hand kann helfen zu verhindern, dass sich die Krankheit von diesen Nestern aus noch schneller ausbreitet. Ernte: Weisse Lupinen reifen spät, d.h. in der Regel Ende August/Anfang September. In sehr heissen Jahren (wie z.B. 2015 und 2018) konnten sie schon in der ersten Augustwoche geerntet werden. Gibt es im Juli/August noch viele Niederschläge, kann sich die Ernte deutlich verspäten, da je nach Sorte und Witterung dann nochmals Seitentriebe gebildet werden. Der richtige Druschzeitpunkt ist erreicht, wenn die Samen in den Hülsen beim Anstossen „klappern“ und das meiste Stroh braun ist (Abbildung 3). Die Hülsen der Weissen Lupinen sind deutlich platzfester als die der Blauen Lupinen. Die Samen sind sehr gross, entsprechend muss der Dreschkorb möglichst weit offen sein. Die Dreschtrommel-Drehzahl sollte auf niedrigster Stufe eingestellt werden, die Windleistung sollte für schnelle Strohabtrennung hoch sein.Bei einer Feuchtigkeit über 14 % sollten die Samen schonend (unter 35 °C Lufttemperatur) nachgetrocknet werden. Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.
Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.
 Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.
Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.
 Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.
Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.
|38|41|
Mehr lesen
LIVESEED wird von der Europäischen Union im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogrammes Horizon 2020 unter dem Fördervertrag Nr. 727230, sowie vom Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation unter der Vertragsnummer 17.00090 gefördert.
2023
Weisse Lupinen (Lupinus albus) sind eine andere botanische Art als schmalblättrige oder „blaue“ Lupinen (Lupinus angustifolius). Sie vertragen schwerere Böden und haben ein höheres Ertragspotential, reifen allerdings erst im August/September. Wichtig für ihren Anbau ist die Verwendung von gesundem, zertifizierten Saatgut, eine möglichst frühe Aussaat und die richtige Sortenwahl, um eine Infektion mit der Pilzkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut verbreitet wird, zu vermeiden. Hier werden die wichtigsten Erfahrungen aus dem ökologischen Anbau zusammengefasst.
Abbildung 1. Die Weisse Lupine.
Anwendbarkeit
Thema: Erfolgreicher Anbau der Weissen Lupine
Für: Anbauer von Körnerleguminosen
Wo: Kalkarme Böden ohne Staunässe
Aussaatzeit: März (April), frühestmöglich
Erntezeit: spät! (August-September)
Technik: entweder Reihenabstand wie Getreide und ein- bis zweimal striegeln, oder 50 cm Reihenabstand und mehrmals hacken. Mähdrescher
Follow-up: Vermarktung vor Aussaat klären. Sehr geeignet als Rohstoff für Nahrungsmittel
Bedeutung: Eiweissfrucht ohne N-Düngung mit sehr guter Vorfruchtwirkung, kältetolerant
Entscheidungshilfen
Bezogen auf den Proteingehalt der Samen und das Aminosäuremuster, sind Weisse Lupinen nach Sojabohnen für Tierfütterung und menschliche Ernährung die wertvollsten Eiweissfrüchte. Die Erträge liegen meist um die 3 t/ha (Schwankungen von 2 bis 4 t/ha sind möglich). Vorteile gegenüber Sojabohnen sind vor allem die Aussaatmöglichkeit bereits im März (Frost bis -5 °C ist kein Problem), eine bessere Vorfruchtwirkung und deutlich sichtbare Blüten, die attraktiv für Hummeln und Bienen sind. Lupinen gedeihen gut auf sauren, phosphorarmen Böden. Nachteile der Weissen Lupinen sind die Gefahr, durch Anthraknose einen grossen Teil der Ernte zu verlieren, Probleme mit Spätverunkrautung, die relativ späte Ernte (Mitte bis Ende August) und ungeklärte Vermarktungsmöglichkeiten.
Zur Vermeidung der Brennfleckenkrankheit
Der wichtigste Schlüssel zum Erfolgist ein Vermeiden der Brennfleckenkrankheit Anthraknose, die über das Saatgut übertragen wird. Daher sollte nur zertifiziertes Saatgut verwendet werden, das auch optisch „sauber“ aussieht. Alle bisher erhältlichen Sorten sind anfällig auf die Krankheit. In Deutschland ist seit 2019 die weniger anfällige Sorte „Frieda“ zugelassen, die sich im Anbau 2019 an zwei Versuchsorten in der Schweiz bewährt hat. Auch die französische Sorte „Sulimo“ erwies sich bisher (an zwei Orten und in drei Versuchsjahren) als weniger anfällig und sehr ertragsstark. Ab 2020 steht auch die laut Züchter weniger anfällige Sorte „Celina“ zur Verfügung, mit der wir aber noch keine Erfahrungen haben. Am wenigsten Probleme mit Anthraknose gibt es auf sommertrockenen, windreichen Standorten mit pH-Werten unter 7.
Erfolgsfaktoren vor dem Anbau
Kalkgehalt des Bodens: Lupinen sind sehr sensibel auf den Kalkgehalt im Boden. Erfahrungen des Forschungsinstituts für biologischen Landbau FiBL in Praxisversuchen zeigen: Bei Gehalten < 3 % ist ein Anbau möglich, zwischen 3-10 % wird ein Tastversuch empfohlen, ab 10 % ist der Anbau nicht möglich. Da Böden mit höherem Kalkgehalt in der Regel auch höhere pH-Werte haben, wird in der Literatur meist nur der pH-Wert als kritische Grösse genannt. In Arbeiten aus Frankreich wurde jedoch gezeigt, dass insbesondere der Kalk (CaCO3) in den feinen Fraktionen Ton und Schluff die Lupinen daran hindert, die Menge an Eisen aus dem Boden aufzunehmen, die die Knöllchen für die Stickstoff-Fixierung brauchen (Duthion 1992). Die Folge ist ein Stickstoffmangel für die Pflanzen, der sich an gelblichen Blättern und kümmerlichem Wachstum zeigt (Kalkchlorose). Auf einem solchen Boden ist auch die Anfälligkeit auf Anthraknose erhöht. Geimpfte Lupinenpflanzen (s. unten) sollten ein kräftiges dunkles Grün haben, ansonsten ist der Boden nicht für den Lupinenanbau geeignet. In der Regel sollte der pH-Wert des Bodens tiefer als 7 sein.
Impfung: Lupinensaatgut muss, wie Soja-bohnen, vor dem Anbau mit Knöllchenbakterien geimpft werden. So können die Wurzeln zusammen mit den Bakterien die Stickstoff-fixierenden Knöllchen bilden, und eine Stickstoff-Düngung ist nicht notwendig. Diese Bodenbakterien sind in Böden, auf denen in den letzten Jahren keine Lupinen angebaut wurden, nicht oder nicht in ausreichender Menge vorhanden. Versuche konnten eindrucksvoll zeigen, dass die Impfung leicht zu einer Verdoppelung oder Verdreifachung des Ertrages führt. Das gängigste dieser Impfmittel ist ein schwarzes Pulver auf Torfbasis, das lebende Bakterien enthält. Es kann zusammen mit dem Saatgut im Saatguthandel bestellt werden und wird am besten direkt vor der Aussaat mit dem Saatgut vermischt, bis die Samen rundum schwarz sind. Da UV-Licht die Bakterien tötet, sollte das Impfmittel oder das fertig geimpfte Saatgut vor Sonnenlicht geschützt und kühl gelagert werden (siehe auch Practice Note 1).
Erfolgsfaktoren während Anbau und Ernte
Unkrautbekämpfung: Im Vorauflauf wird, auch im konventionellen Anbau, eine Unkrautkur (Falsches Saatbett) oder Blindstriegeln empfohlen (bis 3 Tage nach der Aussaat). Besondere Vorsicht ist geboten, um nicht auf die Saat zu fahren. Die Weissen Lupinen können ca. 4-6 Wochen nach der Aussaat gehackt oder gestriegelt werden (Abbildung 2). Weisse Lupinen werden ähnlich wie Soja gehackt (siehe auch Practice Note 2). Idealerweise sollte Hacken/Striegeln nachmittags durchgeführt werden, wenn der Turgor in den Pflanzen geringer ist, um Verletzungen zu vermeiden. Etwa 8 Wochen nach der Aussaat, zu Beginn der Blütezeit, lohnt sich ein Kontrollgang über das Feld bei trockenem Wetter. Zu dieser Zeit sind die ersten Nester von Anthraknose sichtbar (Abbildung 4) und eine Entfernung und Abführung der befallenen Pflanzen von Hand kann helfen zu verhindern, dass sich die Krankheit von diesen Nestern aus noch schneller ausbreitet.
Ernte: Weisse Lupinen reifen spät, d.h. in der Regel Ende August/Anfang September. In sehr heissen Jahren (wie z.B. 2015 und 2018) konnten sie schon in der ersten Augustwoche geerntet werden. Gibt es im Juli/August noch viele Niederschläge, kann sich die Ernte deutlich verspäten, da je nach Sorte und Witterung dann nochmals Seitentriebe gebildet werden. Der richtige Druschzeitpunkt ist erreicht, wenn die Samen in den Hülsen beim Anstossen „klappern“ und das meiste Stroh braun ist (Abbildung 3). Die Hülsen der Weissen Lupinen sind deutlich platzfester als die der Blauen Lupinen. Die Samen sind sehr gross, entsprechend muss der Dreschkorb möglichst weit offen sein. Die Dreschtrommel-Drehzahl sollte auf niedrigster Stufe eingestellt werden, die Windleistung sollte für schnelle Strohabtrennung hoch sein.Bei einer Feuchtigkeit über 14 % sollten die Samen schonend (unter 35 °C Lufttemperatur) nachgetrocknet werden.
Abbildung 2. Unkrautbekämpfung ist vor allem wichtig zur Vorbeugung gegen Spätverunkrautung. Solange die Pflanzen noch relativ klein sind, können sie gestriegelt werden.
Abbildung 3. Blüte, grüne Hülsen und druschreifer Bestand von Weissen Lupinen.
Abbildung 4. Die gefürchtete Brennfleckenkrankheit Anthraknose führt zur Blütezeit zu nesterweise verdrehtem Wuchs der ganzen Pflanzen (links), in der Reifezeit zu schwarzen, verkrümmten Hülsen. (rechts) Zur Blütezeit können die schlimmsten Krankheitsnester von Hand vom Feld entfernt werden.
0_1685456324
1685456324
Keinen passenden Inhalt gefunden?
Mehr Informationen zu Leguminosen finden Sie am Legume Hub.
